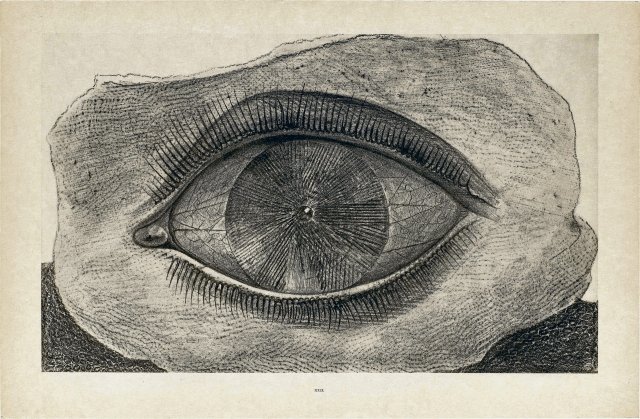- Kultur
- Louis Armstrong
»Satchmo« spielt für alle
Vor 100 Jahren erschien die erste Platte der afroamerikanischen Jazzlegende Louis Armstrong
Der »Chimes Blues« gilt heute als das erste mustergültige Dokument des New Orleans Jazz. Der Titel erschien im Sommer 1923 auf einer Schellackplatte von Gennett Rekords – ohne Nennung des Interpreten: Louis Armstrong. Öffentliche Auftritte und Aufnahmen afroamerikanischer Musiker waren vor 100 Jahren noch eine große Seltenheit; die Plattenfirmen außerhalb der Jazz-Metropole Chicago bevorzugten weiße Bands. Rassentrennung und Rassendiskriminierung, ja sogar Lynchmorde waren noch alltäglich.
Aus bitterer Armut kommend, ist Louis Armstrong seinen Weg gegangen, unbeirrt, trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse im rassistisch-chauvinistischen Amerika. 1901 in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana geboren, verbringt er die ersten Kindheitsjahre bei der Großmutter; der Vater hat die Familie kurz nach Louis’ Geburt verlassen. Mit fünf Jahren wieder zu seiner Mutter zurückgekehrt, wächst der Junge in einem rauen Viertel, genannt »Battleground« (Schlachtfeld) auf, wo er eine Schule für schwarze Kinder besucht. Nebenher verdient er sich etwas Geld durch Gelegenheitsarbeiten für eine arme jüdische Einwandererfamilie, die ihn fast wie ihren eigenen Sohn behandelt. Morris Karnoffsky gewährt Louis sogar einen Vorschuss für den Kauf eines Kornetts (Blasinstrument) in einem Pfandhaus. Aus Dankbarkeit trägt Louis Armstrong Zeit seines Lebens einen Davidstern-Anhänger. Das Musizieren erlernt Louis autodidaktisch, indem er Profis wie Bunk Johnson zuschaut. Mit seinem trompetenähnlichen Blechinstrument tritt er regelmäßig neben dem Trödelwagen der Karnoffskys auf, um Kunden anzulocken. Einer seiner Spitznamen damals, als Afro-amerikaner auf ihr Äußeres reduziert wurden und es keine Political Correctness gab, lautet: »Satchelmouth« (»Quadratfresse«). Louis Armstrong nimmt dies als Herausforderung an. Später zu »Satchmo« verkürzt, wandelt sich die Beleidigung in Bewunderung und Wertschätzung.
Der Teenager lebt abwechselnd bei seiner Mutter, seinem Vater oder im Colored Waif’s Home for Boys. Der Musiklehrer des Heims lässt das 13-jährige Talent erstmals eine Band leiten. Zwischenzeitlich versucht Louis sich erfolglos als Zuhälter einer Prostituierten namens Nootsy, erkennt aber rechtzeitig, dass Musik für ihn der Ausweg aus einem Leben in Hunger und Armut sein könnte. Er erlernt das Lesen von Noten, wird Mitglied der New Orleans Band von Fate Marable und spielt mit ihr ab 1918 auf verschiedenen Mississippi-Dampfern – bis ihn der bekannte Kornettist Joe »King« Oliver schließlich nach Chicago holt, der damaligen Hauptstadt des Jazz. Dort entwickelt Armstrong in den »Roaring Twenties« sein einzigartiges Improvisationstalent. Er wird zu einem der ersten Jazzer, die lange Trompetensoli spielen. Eine Revolution, denn bis dahin wurde Jazz in stark orchestrierten Arrangements oder Dixieland-Gruppen dargeboten. Erstmals als Solist zu hören ist er auf der eingangs erwähnten, in Richmond/Louisiana entstandenen Aufnahme »Chimes Blues« als Mitglied von King Oliver’s Creole Jazz Band.
Der »Chimes Blues« stellt alle früheren Jazzplatten in den Schatten. Nach etwa zwei Dritteln des Stückes legt Louis Armstrong, offiziell nur der zweite Kornettist der Gruppe, mit einem imposanten, 24 Takte kurzen Solo los. Es ist eine Art Vorahnung auf eines der größten Genies der US-amerikanischen Musik aller Zeiten. In den folgenden Jahren wird der Blechbläser fast im Alleingang den Jazz verändern, mit der Pianistin Lil Hardin an seiner Seite, bald die zweite Ehefrau Armstrongs und die erste berühmte Instrumentalistin des Jazz. »You heard the future« (»Sie hörten die Zukunft.«), kommentiert ein berühmter Kritiker Armstrongs Darbietungen. Armstrong beginnt alsbald, bei seinen gefeierten Auftritten auch zu singen, wobei er laufend die Melodie variiert und den Text mit eigenen, spontanen Einfällen anreichert. Eine Innovation, die zum Standard im Jazz und Blues, aber auch im Rock und Pop avanciert.
Der vielseitige Musiker wechselt schließlich zur härter klingenden Trompete und erzählt auf der Bühne Witze, führt gar kleine Sketche auf und covert aktuelle Hits. Seine musikalischen Improvisationen sind dem Gesangsstil orthodox-jüdischer Gebete abgeleitet. Viele Aufnahmen machen seine Frau Lil und er mit Quintett- und Septett-Formationen. Armstrong verfasst eigene Stücke wie das richtungsweisende »Potato Head Blues« (1927), »eine der erstaunlichsten Errungenschaften in der gesamten Musik des 20. Jahrhunderts«, wie ein anderer Kritiker vermerkte.
Armstrong ist stetig unterwegs, er erträgt es nicht, untätig auf dem Sofa zu liegen. Jährlich bestreitet er bis zu 300 Konzerte mit der Weltklasse-Band The All Stars. Dank seines rauen und kehligen Scat-Gesangs, den er seit seinem Hit »Heebie Jeebie« (1926) immer mehr perfektioniert, steigt er zur weltweiten Stimme des Jazz auf.
1958 stellen sich Louis Armstrong, Ella Fitzgerald und ein Studio-Orchester unter der Leitung von Russ Garcia einer ganz besonderen Herausforderung. Sie verjazzen die Oper »Porgy & Bess« von Ira Gershwin über das Leben von Afroamerikanern. Armstrongs und Fitzgeralds wunderschön nuancierte Version von »Summertime« soll dem Komponisten die Tränen in die Augen getrieben haben. Fitzgeralds Lesung des Textes von »It Ain’t Necessarily So« ist herrlich schlüpfrig und bildet einen grandiosen Kontrast zu Armstrongs Gesang und seinen majestätischen Trompetentönen. Zu dessen erfolgreichstem Album wird jedoch die Musical-Aufnahme »Hello, Dolly!« (1964).
Armstrong lässt Einflüsse wie Blues, lateinamerikanische Volkslieder, klassische Sinfonien und Opern in seine Interpretationen einfließen und verwirrt damit manchmal auch seine Fans. Mit den schließlich aufkommenden modernen Jazz-Strömungen kann der ältere Armstrong dann aber nur wenig anfangen, nennt beispielsweise Bebop »chinesische Musik«. Charlie Parker und Miles Davis hingegen betrachten ihren neuartigen Sound als abstrakte Kunst und tun Armstrongs unterhaltende Musik als unmodern ab. Sie werfen ihm zudem vor, sich nicht aktiv in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung zu engagieren. Diese Art von Kritik hält »Satchmo« nicht davon ab, sein Publikum in der ganzen Welt mit virtuosem Trompetenspiel und Gesang zu unterhalten. Zwischen 1936 und 1969 wirkt er nebenbei in zahlreichen Hollywood-Produktionen und einigen deutschen Unterhaltungsfilmen mit. Letztlich hat er allein mit seiner Präsenz in der Weltöffentlichkeit, mit seiner Virtuosität und Geradlinigkeit einen eigenen, nicht zu unterschätzenden Beitrag gegen Rassenhass und nationale Überheblichkeit geleistet.
Trotz Rassentrennung im eigenen Land schicken die USA den Afroamerikaner als Kulturbotschafter des Jazz und »musikalischen Mobilmacher« regelmäßig in die weite Welt hinaus. 1965 gibt Armstrong mit den All Stars 17 Konzerte in der DDR – als erster US-Entertainer überhaupt. Die Künstleragentur des ostdeutschen Staates hat ihn als »Kämpfer gegen den Rassismus« eingeladen, was sein Roadmanager Frenchy etwas frech kommentierte: »Herr Armstrong bläst seine Trompete für Schwarze und Weiße, Juden, Araber, Katholiken. Wenn es sein muss, auch für Pinguine am Südpol.« In den Sälen von Berlin über Leipzig bis Erfurt kocht die Begeisterung und Leidenschaft jedenfalls regelrecht über während seiner Shows.
1971 stirbt Louis Armstrong in New York City. Bis zum letzten Tag ist der Weltstar ein bodenständiger Mensch geblieben, der im Arbeiterstadtteil Queens in einem bescheidenen Haus lebte und sich beim Friseur um die Ecke die Haare schneiden ließ. Zu seiner Hinterlassenschaft gehören zwölf Songs in der Grammy Hall of Fame – und vier Ex-Frauen, aber keine Kinder.
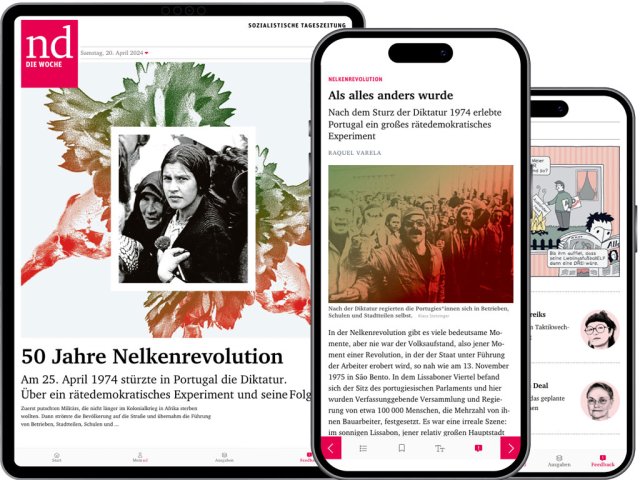
In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.